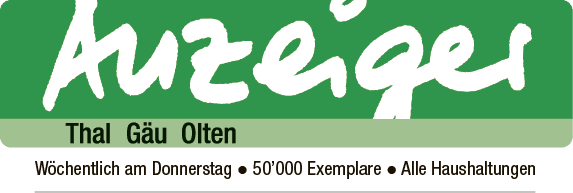Die Geschichte der Schweiz ist untrennbar mit dem Mythos Wilhelm Tell verbunden. Egal, ob es ihn gab oder nicht: Die Geschichte ist gut. Auf eine kuriose Art verleiht sie uns eine stolze Identität, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Tell als Kämpfer gegen die widrigen Umstände. Ein starker Mann. Schiller legte ihm die Worte in den Mund: «Der Starke ist am mächtigsten allein!». Und was machen die Schwachen, die gerne mächtig wären? Politische Führer unserer Zeit haben es verstanden. Sie sind mächtig, weil sie nicht allein sind. Weil andere ihre Ideen und Taten unterstützen. Auch wenn diese auf Spaltung, Tumult und Verunsicherung abzielen. Vielleicht gerade deshalb.
Beängstigend, wie viel Zuspruch solche Ideen erhalten. Wie Menschen nach Macht lechzen. Wieviel Macht ein einzelner Mensch bekommen kann. Auch wenn er nicht stark ist. Dass «sich trumpieren» ein schweizerdeutscher Ausdruck für «sich irren» ist und «putin » auf französisch ein Schimpfwort, ist möglicherweise nicht nur Wortspielerei. Doch es geht hier nicht nur um die Grossen des Weltgeschehens. Machtgelüste, Spaltung und Schräglage in unserer Gesellschaft sind allenthalben spürbar.
Es ist Zeit, Haltung zu zeigen. «Gring abe» und hoffen, dass es vorbei geht, ist nicht die Lösung. Denn es ist nicht in Ordnung, dass Rechtsextremismus auf dem Weg zur Salonfähigkeit ist. Es ist verheerend, wenn Bildung gekürzt wird. Erschreckend, wenn versinkende Inseln mit einem Schulterzucken quittiert werden. Alles zu gross für uns? Nur dann, wenn wir allein sind.
Martina Flück meint, «möge die Macht mit uns sein».